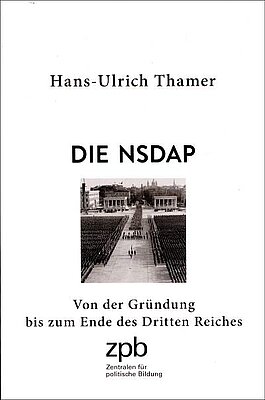31. Mai 1998: 25. Todestag von Künstlerin Lotti Huber
In einem Alter, in dem andere Leute sich ins Rentendasein zurückziehen, machte Lotti Huber richtig Karriere. Mit klimpernden Wimpern, auffälligem Schmuck und scheinbar untrübbarer Lebensfreude wurde sie zum Bühnenliebling und zu einem Darling der queeren Szene.
Ins Leben getanzt
Dass Tanzen einmal ihr Leben bestimmen würde, schien vorgezeichnet: Johanna Goldmann war mit ihrer Tochter Charlotte hochschwanger, als Johannas Bruder zu Besuch kam und mit ihr um den Esstisch der Familie herum Walzer tanzte. Die Mutter habe sie „in die Welt getanzt“, sagte Lotti Huber später, denn auf den Wiegeschritt folgten die Wehen – am nächsten Morgen, dem 16. Oktober 1912, war Charlotte Dora Goldmann auf der Welt.
Sie wuchs in einem großbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Kiel auf. Die Eltern ermöglichten der tanzbegeisterten Tochter Ballettunterricht. Als junges Mädchen verliebte sie sich in Hillert Lueken, den Sohn des Kieler Oberbürgermeisters. Doch unter den Nationalsozialisten waren Beziehungen zwischen einem jüdischen Mädchen wie ihr und einem „Arier“ wie Lueken verboten. Das verliebte Paar ignorierte die Rassengesetze der Nazis und ging gemeinsam nach Berlin. Von einer früheren Schulfreundin wegen „Rassenschande“ 1937 denunziert, wurden die beiden von der Gestapo verhaftet. Hillert Lueken wurde in Berlin in Untersuchungshaft erschossen. Die 25-jährige Charlotte wurde im KZ Moringen inhaftiert und später ins KZ Lichtenburg verlegt.
Haft im Konzentrationslager
Über ihre Zeit im KZ schrieb Lotti Huber in ihrer Autobiografie „Diese Zitrone hat noch viel Saft“, die 1990 zum Bestseller wurde: „Wenn ich an die Zeit im Konzentrationslager denke, habe ich alles wieder vor Augen. Welche Absurdität, welcher Wahnsinn, welche abgrundtiefe menschliche Schlechtigkeit.“
Dem Engagement ihres Bruders Kurt verdankte sie es, dass sie 1938 freigekauft wurde und nach Haifa, Palästina, emigrieren konnte. Dort studierte die kaum 1,50 Meter große Frau Tanz und Pantomime und trat dann im Cabaret auf. In Haifa lernte sie auch ihren ersten Mann kennen, einen britischen Offizier. Das Paar zog nach Zypern – damals noch eine britische Kolonie – und betrieb dort ein Hotel. Nach der Scheidung eröffnete Lotti Huber das Restaurant „The Octopus“. Hier zeigte sich, dass die Chefin auch Entertainerin war; ihr Restaurant soll eines der beliebtesten am Ort gewesen sein. Auf Zypern traf sie ihren zweiten Mann, wieder ein Brite: Mit Norman Huber ging sie erst nach London und kehrte 1965 nach Deutschland zurück.
Mit über 60 zum Film
Als Norman Huber 1973 starb, durchlebte sie eine tiefe Trauerphase. Dann besann sie sich auf ihre Anfänge und gab in ihrer Wohnung Tanzunterricht, inspiriert von den Ausdruckstänzerinnen Isadora Duncan und Mary Wigmann: Huber lehrte ihre Schülerinnen und Schüler große, raumgreifende Bewegungen.
Auch sie selbst nahm sich Raum und verstieß dabei gegen Tabus. Sie kleidete sich auffällig in wallenden, farbenfrohen Kleidern mit großen Ketten und den Fingern voller Ringe. Sie schminkte sich bis ins hohe Alter, blinzelte ihr Gegenüber mit ihren langen, künstlichen Wimpern an und band sich die Haare meist zum großen Dutt zusammen, betont von einem breiten, glitzernden Haarreif.
Lotti Huber fiel auf und bekam mit über 60 Jahren Statistinnenrollen beim Film. Anfang der 1980er traf sie Regisseur Rosa von Praunheim, mit dem sie über ein Jahrzehnt zusammenarbeitete. Praunheim, Aktivist in der queeren Szene, machte Huber mit seinem halb-dokumentarischen Film „Unsere Leichen leben noch“, in dem sie neben vier anderen älteren Frauen spielte, einem breiteren Publikum bekannt.
Ihr leichtes Lispeln und das norddeutsche spitze „st“, gemischt mit Berliner Dialekt-Vokabeln und ihrem Äußeren: Kein Wunder, dass Lotti Huber sich den Zuschauerinnen und Zuschauern einprägte. Es folgten weitere Filmauftritte; etwa in Hans W. Geißendörfers „Der Zauberberg“ und in Rosa von Praunheims „Anita – Tänze des Lasters“, die sie auch in der queeren Szene beliebt machten. Ihre engsten Freunde waren schwule Männer.
Sie sahen und erlebten eine Lotti Huber, die neugierig und aufgeschlossen für die Jugend war und ohne Berührungsängste gegenüber Menschen, die nicht geschlechtskonform auftraten. Eine Frau, die im Alter befreit lebte. Ob sie sich noch irgendetwas vorschreiben ließe, fragte Late-Night-Talker Harald Schmidt sie 1995. „Das ist ein Versuch am ungeeigneten Objekt“, antwortete sie trocken.

Kampfansage an Klischees über das Alter
Wer den traumatischen Abgrund aus ihrer Jugend kannte, fragte sich, wie Lotti Huber so lebensfroh und zugewandt sein konnte. Umstehende redete sie beinahe immer mit „Liebling“ an. Manche Freunde, darunter Filmemacher Rosa von Praunheim, vermuteten hinter Lotti Hubers fortwährender Fröhlichkeit auch eine Fassade, um sich vor traumatischen und aufwühlenden Erinnerungen zu schützen. Im halb-biografischen Film „Affengeil“, der unter Rosa von Praunheims Regie entstand, brach Lotti Huber die Dreharbeiten in einer Szene ab, als ein 86-Jähriger Berliner sich in antisemitischen Tiraden erging: Einem judenfeindlichen Alten mit festgefahrenen Meinungen habe sie nichts zu sagen.
Dem Gespräch mit verknöcherten Menschen verweigerte sie sich – sie selbst lebte ihr Alter als Gegenbeweis zu der Erwartung, betagte Menschen müssten konventionell, unauffällig und in der Gesellschaft möglichst unsichtbar sein. 1995, knapp drei Jahre vor ihrem Tod, erzählte sie in der Late-Night-Show von Harald Schmidt: „Bei mir sagen sie immer: ‘Wat macht die Olle noch auf der Bühne? Warum geht sie nicht mit ihrem Dackel spazieren und gießt Blumen auf dem Balkon?‘ Aber das ist einfach nicht meine Masche!“
Erst der Herztod konnte Lotti Huber stoppen. Sie starb am 31. Mai 1998. Getanzt hatte sie bis zuletzt für ihr Leben gern.